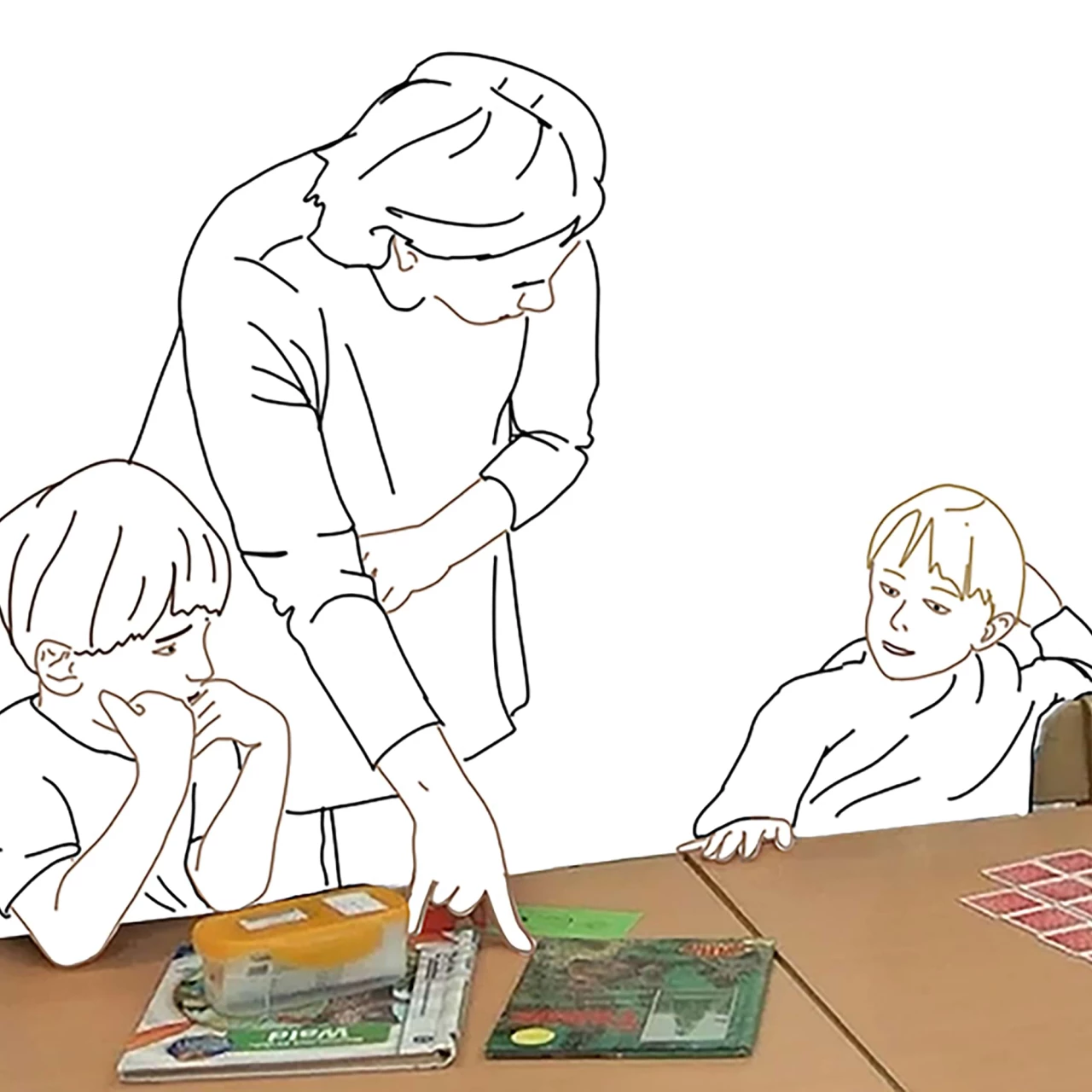- Titel
- Alltagsgespräche als Bildungschancen auf der Unterstufe
- Projektleitung
- Mitarbeitende
- Projektbeschreibung
In der Schweiz besteht klarer Handlungsbedarf bezüglich Chancengerechtigkeit und Sprachfähigkeiten der leistungsschwächsten Schüler:innen (OECD 2019, 2023). Die sprachlichen Fähigkeiten beim Eintritt in die erste Klasse beeinflussen die sprachliche Leistungsentwicklung während der gesamten obligatorischen Schulzeit (Angelone et al. 2013). Frühe Sprachbildung im Zyklus I kann deshalb einen nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung der Bildungschancen aller Kinder leisten: Wenn Kinder über die im Unterricht benötigten sprachlichen Fähigkeiten verfügen, können sie die schulischen Bildungsangebote von Anfang an besser nutzen (Vieluf et al. 2020). Dabei geht es nicht nur um Deutschkenntnisse, sondern auch und zentral um mündliche Texte wie Berichten, Erzählen, Erklären oder Argumentieren (Isler et al. 2018). Ziel ist es, dass alle Kinder beim Schuleintritt mit diesen «ways with words» der Schule vertraut werden (Heath 1983). Das Team «Frühe Sprachbildung» hat seit 2012 in zwei SNF-Studien zunächst den kommunikativen Alltag im Kindergarten (Video-Ethnografie ProSpiK) und danach die Zusammenhänge zwischen Lehrpersonenhandeln und Diskursfähigkeiten der Kinder (Interventionsstudie EmTiK) untersucht. Die Ergebnisse bestätigen die Bedeutung einer qualitativ guten Erwerbsunterstützung durch die Lehrpersonen für die Entwicklung mündlicher Textfähigkeiten der Kinder und zeigen, dass sich das Lehrpersonenhandeln durch Weiterbildung wirksam verbessern lässt (Isler et al. 2024).
In der neuen Studie AllBi-U wird nun das sprachliche Bildungspotenzial von Alltagsgesprächen unter den institutionellen Bedingungen der Unterstufe erforscht. Den konzeptionellen Rahmen bildet das Angebots-Nutzungs-Modell von Vieluf et al. (2020), welches die Ko-Konstruktion von Bildungsangeboten durch Lehrpersonen und Schüler:innen berücksichtigt (Fend 1998). Auf diesem Modell aufbauend sollen vier Forschungsfragen bearbeitet werden:
Welche Gelegenheiten für mündliche Textproduktionen zeigen sich im kommunikativen Alltag der untersuchten ersten und zweiten Klassen?
Wie werden diese Gelegenheiten als Bildungsangebote durch die Lehrpersonen und Schüler:innen interaktiv ausgestaltet?
Welche Bedingungen sind für die Ausgestaltung dieser Bildungsangebote bedeutsam?
3.1 Die individuellen Voraussetzungen und das Erleben der Schüler:innen
3.2 Die individuellen Voraussetzungen und das Erleben der Lehrpersonen
3.3 Die institutionellen Bedingungen der Unterstufe
Wie verändern sich die Gelegenheiten, die interaktive Ausgestaltung und die Bedingungen von der ersten zur zweiten Klasse?
Methodisch ist das Projekt AllBi-U als videobasierte fokussierte Ethnografie (Tuma et al. 2013) angelegt. Der kommunikative Alltag wird jeweils während einer Woche mit einer mobilen Handkamera und zwei stationären Raumkameras gefilmt. Das Geschehen wird in Logbüchern dokumentiert und ausgewählte Sequenzen werden in interdisziplinären Datensitzungen videosequenzanalytisch ausgewertet. In den je vier Klassen des Startsamples und des Vertiefungssamples werden im ersten und im zweiten Schuljahr längsschnittliche Daten erhoben. Die Klassen des Vertiefungssamples werden durch theoretical sampling (Glaser & Strauss 2005) ausgewählt. Im zweiten und dritten Projektjahr werden in weiteren Klassen kürzere Erhebungen durchgeführt, um spezifische Fragen weiterzuverfolgen und Befunde zu validieren. Zur Beantwortung der Fragen 3a und 3b werden Gruppeninterviews mit Kindern und Einzelinterviews mit Lehrpersonen durchgeführt, induktiv kodiert (Glaser & Strauss 2005) und mit den Rekonstruktionen der Videoanalysen trianguliert (Flick 2003).
AllBi-U ist als Fokusmodul der Zürcher Lernverlaufsstudie LEAPS konzipiert. Der Feldzugang erfolgt über die LEAPS-Stichprobe, und für die Samplebildung können LEAPS-Daten beigezogen werden. Inhaltlich kooperiert AllBi-U mit der LEAPS-Kernstudie sowie mit dem LEAPS-Fokusmodul «Pädagogischer Kontext» (Keller, Maag Merki & Praetorius).
- Laufzeit
- 08.2025 – 07.2029
- Projektstatus
- Laufend
- Kooperationspartner
- Finanzierung
-
-